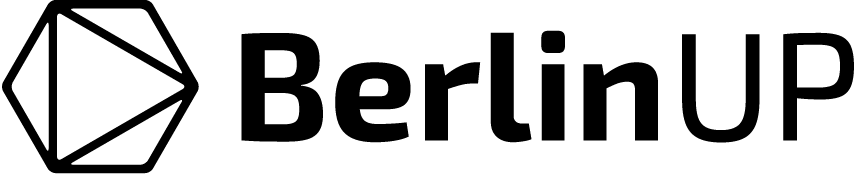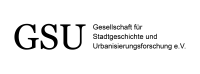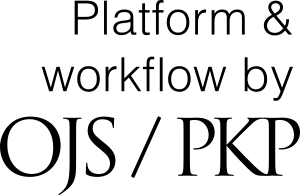Die Stadt als Bühne öffentlicher Totenfeiern. Paris, London und Berlin im Vergleich
DOI:
https://doi.org/10.60684/msg.v56i1.80Abstract
Dieser Aufsatz untersucht das Verhältnis zwischen öffentlichen Totenfeiern und städtischen Räumen und analysiert, wie solche Ereignisse die städtische Infrastruktur und symbolische Topographie prägen und gleichzeitig von ihr beeinflusst werden. Öffentliche Begräbnisse in Paris, London und Berlin fungierten sowohl als politisch aufgeladene Rituale als auch als Ausdruck kollektiver Trauer und hinterließen bleibende Spuren in Form nationaler Ruhmeshallen und Begräbnisstätten. Vergängliche Elemente wie die Aufbahrung der Toten, Trauerzüge und Trauerdekorationen veränderten den Stadtraum temporär und verstärkten seine symbolische Bedeutung.
Im Rahmen einer vergleichenden Analyse wird gezeigt, wie diese Städte von der Französischen Revolution bis in das späte 20. Jahrhundert als Bühnen öffentlicher Trauerfeiern fungierten. Der Wandel von elitären königlichen Bestattungen hin zu breiter angelegten, staatlich inszenierten Zeremonien verdeutlicht die Wandelbarkeit von Bestattungspraktiken. Anhand ausgewählter Beispiele wird herausgearbeitet, wie unterschiedliche politische Systeme die räumliche Gestaltung und die Bedeutung dieser Ereignisse beeinflussten. Öffentliche Trauerfeiern dienten über den reinen Gedenkakt hinaus als Instrumente politischer Repräsentation und städtischer Identitätsbildung. Sie verankerten sich im historischen Gedächtnis und verdeutlichten die dynamische Wechselwirkung zwischen Zeremoniell, Politik und Stadtstruktur.
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Verena Kümmel

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.