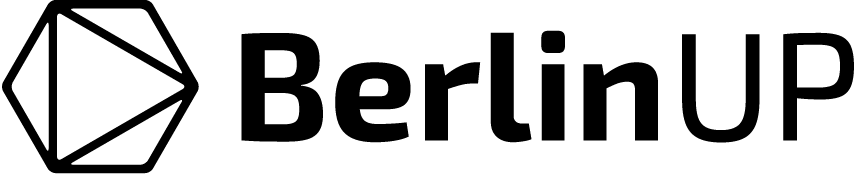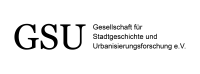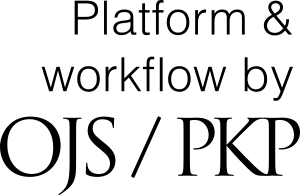Stadt, Friedhof und Natur. Zur Entwicklung landschaftlicher Friedhöfe im urbanen Raum vom 18. bis zum frühen 21. Jahrhundert
DOI:
https://doi.org/10.60684/msg.v56i1.84Abstract
Im bürgerlichen Zeitalter wurden neue Muster der Gestaltung städtischer Friedhöfe und überhaupt der Bestattungskultur entwickelt, wobei „Natur“ und „Landschaft“ als zentrale Orientierungspunkte dienten. Bedeutende, wegweisende Beispiele waren die Grabstätten des Hamburger Dichters Klopstock für seine Frau Meta (1758) und des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau im Park von Ermenonville bei Paris (1776/78). Auch das philosophische Denken wandte sich der Synthese von Tod, Friedhof und Natur zu. In seiner Theorie der Gartenkunst, veröffentlicht 1779-85, entwirft der Kieler Professor für der Kieler Philosophieprofessor Christian Cay Lorenz Hirschfeld den Friedhof als eine Parklandschaft nach englischem Vorbild. Reale Anlagen folgten bald, nicht zuletzt weil die Idee des Gartens als kulturgeschichtlich verankerte Imagination eines irdischen Paradieses eine wichtige Rolle spielte. Wegbereiter des städtischen Friedhofs als Landschaftspark war der 1804 eröffnete Friedhof Père-Lachaise in Paris. In Deutschland wurde der Schweriner Hauptfriedhof 1863, der Kieler Südfriedhof 1869 eröffnet; Bremen-Riensberg (1875) und Hamburg-Ohlsdorf (1877) folgten. Dort schien die naturnahe Friedhofslandschaft zunehmend eine Alternative zur städtischen Industriegesellschaft zu bieten. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts hat die Synthese von Tod und Natur eine neue Dynamik angenommen. Sogenannte Naturbestattungen entfernen sich vom traditionellen Friedhof – unter anderem in Wäldern, wo der Baum zum Erinnerungsmal wird. Zugleich richten auch kommunale Stadtfriedhöfe solche Baumbestattungsflächen ein.
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Norbert Fischer

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.